Private Internetnutzung am Arbeitsplatz

Wir sind bekannt aus:
Top 3 Anbieter für rechtssichere Website-Lösungen
-
Zum Anbieter
Testurteil
1,5
2025
Sehr gut
-
Zum Anbieter
Testurteil
1,7
2025
Sehr gut
-
Zum Anbieter
Testurteil
1,9
2025
Sehr gut
Was darf ich am Arbeitsplatz privat online machen – und was nicht?
Die private Internetnutzung ist in vielen Jobs gelebter Alltag: mal eben Mails checken, das Bankkonto prüfen oder sogar am eigenen Webprojekt basteln.
Doch so selbstverständlich die Nutzung erscheint, so klar geregelt ist sie rechtlich. Wer im Job privat surft, bewegt sich oft in einer Grauzone – mit teils drastischen Konsequenzen.
Besonders Webseitenbetreiber sollten wissen, was erlaubt ist.
Dieser Artikel bietet einen verständlichen Überblick über Rechte, Pflichten und Risiken – und gibt konkrete Tipps, wie du dich und dein Projekt absicherst.
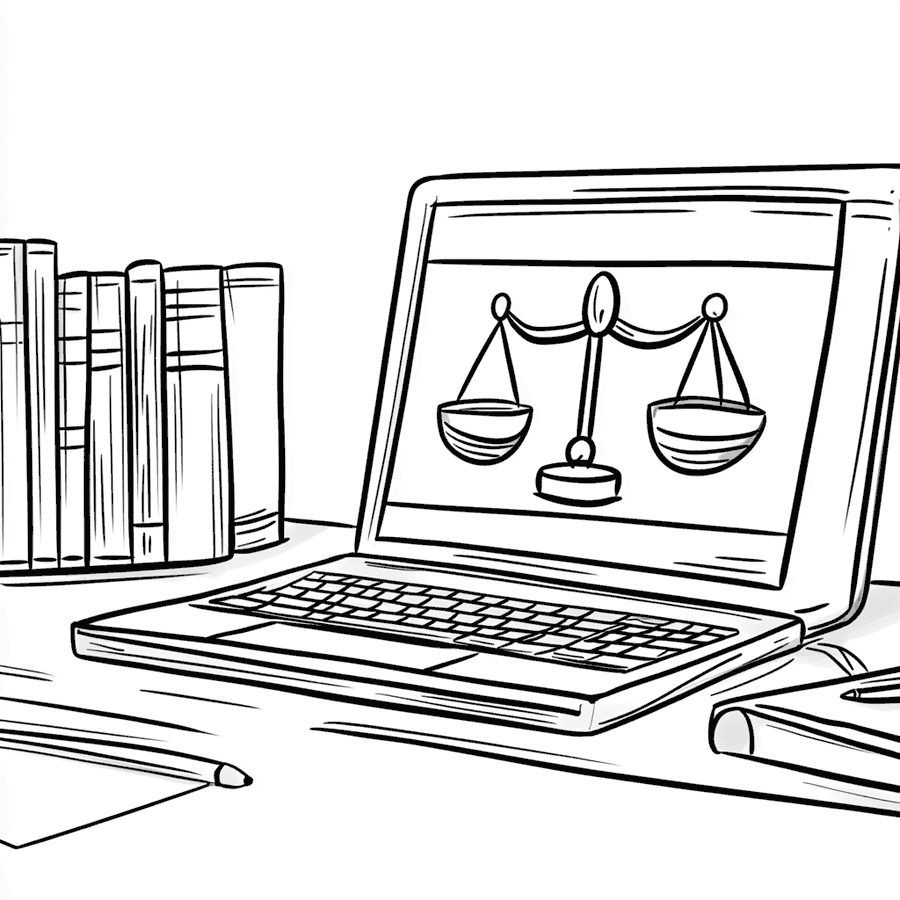
In diesem Artikel
- Private Internetnutzung – ein unterschätztes Risiko?
- Rechtsrahmen – Was gilt im Arbeitsverhältnis?
- Was ist erlaubt – und was nicht?
- Konsequenzen – Was droht bei Pflichtverstößen?
- Kontrolle & Datenschutz – Was darf der Arbeitgeber?
- Homeoffice & mobile Arbeit – was gilt außerhalb des Büros?
- Rechtsprechung & Praxisfälle – was sagen die Gerichte?
- Handlungsempfehlungen für Websitebetreiber
- Fragen und Antworten
1. Private Internetnutzung – ein unterschätztes Risiko?
Zwischen Alltag und Arbeitsrecht
Du sitzt im Büro, der nächste Kundentermin lässt auf sich warten, und du nutzt die Zeit, um deine private Website zu aktualisieren. Ein neues Plugin, ein frischer Blogbeitrag oder ein kleiner CSS-Feinschliff – schnell erledigt, denkst du. Was für viele selbstverständlich ist, kann jedoch erhebliche arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
Denn: Auch wenn du denkst, „das macht doch jeder“ – die private Internetnutzung während der Arbeitszeit oder über betriebliche Geräte ist rechtlich nicht automatisch erlaubt. Sie kann eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten darstellen, selbst wenn sie nur gelegentlich oder nebenbei erfolgt.
Private Nutzung – mehr als nur Webdesign
Die Arbeit an einer privaten Website ist nur ein Beispiel. Zu privater Internetnutzung zählen u. a.:
- das Abrufen und Beantworten privater E-Mails
- Online-Banking während der Arbeitszeit
- das Scrollen durch soziale Netzwerke
- Online-Shopping über den Dienstrechner
- das Streamen von Musik oder Podcasts
- die Nutzung von Webtools wie Google Analytics oder Canva für private Zwecke
Gerade digitale Berufsbilder, bei denen der Rechner ohnehin das Hauptarbeitsmittel ist, bergen hier ein erhöhtes Risiko. Viele Tätigkeiten lassen sich technisch kaum voneinander trennen – aber rechtlich sehr wohl.
Warum Webseitenbetreiber besonders betroffen sind
Webseitenprojekte benötigen Pflege: Inhalte müssen aktuell gehalten, technische Updates durchgeführt, SEO-Strategien umgesetzt werden. Viele Websitebetreiber erledigen diese Aufgaben „zwischendurch“ – oft unbewusst während der Arbeitszeit oder mit betrieblichen Mitteln. Doch wer damit gegen Regelungen zur IT-Nutzung verstößt oder gar gegen eine Nebentätigkeitsklausel, riskiert arbeitsrechtliche Schritte – von der Abmahnung bis zur Kündigung.
Worum es in diesem Artikel geht
Wir zeigen dir, was erlaubt ist – und was nicht. Du erfährst:
- welche rechtlichen Grundlagen greifen
- wie dein Arbeitgeber kontrollieren darf
- welche Sanktionen bei Verstößen drohen
- welche Rechte du hast – gerade im Homeoffice
- und wie du dich als Webseitenbetreiber absicherst
So kannst du dein Projekt voranbringen, ohne deinen Job zu gefährden.
2. Rechtsrahmen – Was gilt im Arbeitsverhältnis?
Die private Nutzung des Internets im Job ist kein rechtsfreier Raum. Wer während der Arbeitszeit privat surft, an einer eigenen Website arbeitet oder sogar eigene Einnahmen erzielt, muss sich verschiedener rechtlicher Grenzen bewusst sein. Welche Gesetze greifen, wann eine Nutzung zulässig ist – und wann nicht – erklären wir in diesem Abschnitt.
Arbeitsvertragliche Hauptpflicht: Arbeitszeit ist Arbeitszeit
Die Grundlage des Arbeitsverhältnisses bildet § 611a BGB. Arbeitnehmer sind verpflichtet, während der vereinbarten Arbeitszeit ihre volle Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Private Tätigkeiten – sei es das Schreiben von E-Mails, das Betreuen eines Webprojekts oder das Streamen von Musik – fallen grundsätzlich nicht darunter.
Wird die Arbeitszeit zur Erledigung privater Aufgaben genutzt, kann das als Verletzung der Hauptleistungspflicht gewertet werden. Die Folge: eine Abmahnung oder, bei Wiederholung, sogar eine Kündigung.
Dienstmittel sind zweckgebunden
Auch technische Ressourcen wie Firmenlaptop, Internetzugang oder E-Mail-Konto sind sogenannte Dienstmittel. Sie dürfen nur im Rahmen des dienstlichen Zwecks verwendet werden – es sei denn, der Arbeitgeber erlaubt eine private Nutzung ausdrücklich oder duldet sie über längere Zeit.
Nutzt du den Dienstrechner, um etwa über ein CMS an deiner privaten Website zu arbeiten, kann das einen Pflichtverstoß darstellen – selbst in der Mittagspause, sofern der Arbeitgeber keine private Nutzung gestattet hat.
Datenschutzrechtliche Vorgaben
Private Internetnutzung und betriebliche Kontrolle überschneiden sich schnell mit dem Datenschutz. Das bedeutet: Sobald der Arbeitgeber Daten über dein Surfverhalten oder deine Webaktivitäten erhebt, gelten die Vorgaben der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG).
Die Kontrolle muss grundsätzlich:
- auf einem berechtigten Interesse beruhen
- verhältnismäßig sein
- und transparent kommuniziert werden
Ohne deine Einwilligung darf der Arbeitgeber in der Regel keine umfassende Inhaltskontrolle (z. B. E-Mail-Lesung) durchführen – selbst wenn du private Nutzung begangen hast. Wie viel Kontrolle erlaubt ist, hängt dabei davon ab, ob private Internetnutzung erlaubt, geduldet oder verboten ist und welcher Verstoß im Raum steht.
Beteiligung des Betriebsrats
In Betrieben mit Betriebsrat hat dieser bei allen Maßnahmen zur Kontrolle und Regelung von Internetnutzung ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Eine IT-Richtlinie oder Überwachungssoftware darf ohne Zustimmung des Betriebsrats nicht eingeführt werden.
3. Was ist erlaubt – und was nicht?
Ob du am Arbeitsplatz privat im Internet surfen darfst, hängt nicht vom Zufall oder der Gutmütigkeit des Vorgesetzten ab, sondern von klaren rechtlichen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist vor allem: Gibt es eine Regelung – und wenn ja, welche? In der Praxis ergeben sich drei typische Konstellationen: Erlaubnis, Duldung oder Verbot.
Ausdrückliche Erlaubnis: Regelungen mit Klarheit
Am sichersten ist eine schriftlich festgelegte Erlaubnis – zum Beispiel im Arbeitsvertrag, in einer IT-Richtlinie oder in einer Betriebsvereinbarung. Diese kann den Umfang der privaten Nutzung genau regeln, etwa:
- nur in der Mittagspause
- maximal 30 Minuten pro Tag
- keine Nutzung betrieblicher Geräte
- nur mit eigener Datenverbindung
Solche Regelungen geben beiden Seiten Rechtssicherheit. Wichtig: Die Erlaubnis kann jederzeit geändert oder widerrufen werden – allerdings nur mit Vorankündigung.
Stillschweigende Duldung: keine verlässliche Grundlage
Wird private Internetnutzung vom Arbeitgeber über längere Zeit toleriert – etwa, weil keine Kontrolle erfolgt oder niemand einschreitet –, kann eine sogenannte betriebliche Übung entstehen. Dann darfst du davon ausgehen, dass gewisse Nutzungen erlaubt sind – zum Beispiel gelegentliches E-Mail-Lesen oder kurze private Recherchen.
Aber: Diese Duldung gilt nur im bisherigen Umfang. Wird aus dem gelegentlichen E-Mail-Check plötzlich regelmäßige Websitepflege, kann das ein Verstoß sein. Auch eine betriebliche Übung kann vom Arbeitgeber widerrufen werden – jedoch nicht abrupt.
Ausdrückliches Verbot: klare Ansage, klare Konsequenz
Gibt es ein Verbot im Arbeitsvertrag oder in einer IT-Richtlinie, ist die Sache eindeutig: Jede private Nutzung ist untersagt – unabhängig vom Umfang oder Inhalt. Selbst kurzes Social Media-Surfen oder ein privater Chat gelten dann als Verstoß. Gleiches gilt, wenn du während der Arbeitszeit an deiner Website arbeitest – auch wenn es „nur“ ein neues Bild ist oder ein Plugin-Update.
Was wird überhaupt als „private Nutzung“ gewertet?
Nicht jede Tätigkeit wiegt gleich schwer. Ein kurzes Googeln einer Wegbeschreibung ist anders zu bewerten als das Bearbeiten von Kundenanfragen auf der eigenen kommerziellen Website. Faustregel:
| Beispiel | Risiko bei Verbot |
| Private E-Mails lesen | gering – aber abmahnfähig |
| Social Media durchscrollen | mittel – je nach Umfang |
| Podcast hören mit Dienstgerät | mittel – auch wegen Datenvolumen |
| Website bearbeiten (CMS) | hoch – klare Zweckentfremdung |
| Kundendaten verwalten (privat) | sehr hoch – Datenschutzproblem |
4. Konsequenzen – Was droht bei Pflichtverstößen?
Wer am Arbeitsplatz gegen Regeln zur privaten Internetnutzung verstößt, muss mit arbeitsrechtlichen Folgen rechnen. Die Konsequenzen hängen maßgeblich vom Ausmaß der Nutzung, der Häufigkeit, der Art der Tätigkeit und der Frage ab, ob eine Erlaubnis vorlag. Von der einfachen Ermahnung bis zur fristlosen Kündigung ist alles möglich.
Ermahnung: Der erste Hinweis
Bei geringfügigen Verstößen – zum Beispiel dem einmaligen Lesen privater E-Mails auf dem Dienstrechner – erfolgt häufig zunächst eine Ermahnung. Sie ist noch keine arbeitsrechtliche Maßnahme im engeren Sinn, sondern ein informeller Hinweis des Arbeitgebers, dass ein bestimmtes Verhalten unerwünscht ist.
Ermahnungen erscheinen nicht in der Personalakte und haben keine unmittelbaren rechtlichen Folgen – sie können aber Vorboten für spätere Maßnahmen sein.
Abmahnung: Die offizielle Warnung
Verstöße, die über das gelegentliche Surfen hinausgehen – etwa das Bearbeiten privater Webprojekte während der Arbeitszeit – führen häufig zur Abmahnung. Diese wird schriftlich ausgesprochen, dokumentiert den Pflichtverstoß und dient als Warnung: Bei Wiederholung droht die Kündigung.
Beispiel: Du arbeitest während der Arbeitszeit regelmäßig an deinem privaten Onlineshop oder bearbeitest Blogbeiträge über das Firmennetz – obwohl die Nutzung untersagt ist. In diesem Fall ist eine Abmahnung rechtlich zulässig und wirksam.
Ordentliche Kündigung: Wiederholungsfall oder Vertrauensbruch
Kommt es nach einer Abmahnung erneut zu einem Verstoß, kann der Arbeitgeber eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. Voraussetzung ist, dass die private Nutzung das Arbeitsverhältnis erheblich belastet hat – etwa durch Zeitverlust, Sicherheitsprobleme oder die Gefährdung betrieblicher Interessen.
Auch ohne Abmahnung kann eine Kündigung zulässig sein, wenn der Pflichtverstoß so schwer wiegt, dass das Vertrauensverhältnis zerstört ist.
Fristlose Kündigung: Im Extremfall möglich
In besonders schweren Fällen ist sogar eine fristlose Kündigung nach § 626 Absatz 1 BGB möglich. Das ist der Fall, wenn ein Arbeitnehmer massiv und bewusst gegen seine Pflichten verstößt – etwa durch:
- stundenlange private Internetnutzung
- die Installation privater Software auf dem Dienstrechner
- die Nutzung illegaler Inhalte (z. B. Streaming, Filesharing)
- sicherheitskritische Handlungen (z. B. Download infizierter Dateien)
Solche Fälle wurden mehrfach von Arbeitsgerichten bestätigt – oft mit dem Hinweis, dass bereits ein einziger schwerwiegender Verstoß genügen kann, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen.
Schadensersatz: Wenn private Nutzung Folgen hat
Wird durch private Nutzung ein konkreter Schaden verursacht – etwa ein Virusbefall des Firmennetzwerks, Datenverlust oder eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzungen – kann der Arbeitnehmer haftbar gemacht werden.
Beispiel: Du installierst ein veraltetes WordPress-Plugin mit einer bekannten Sicherheitslücke. Darüber wird Schadsoftware eingeschleust, die das Firmennetz lahmlegt. In diesem Fall kann der Arbeitgeber unter Umständen Schadensersatz nach § 280 BGB verlangen.
5. Kontrolle & Datenschutz – Was darf der Arbeitgeber?
Sobald es um die Kontrolle privater Internetnutzung geht, geraten zwei Rechte miteinander in Konflikt: das Interesse des Arbeitgebers an der Einhaltung betrieblicher Regeln – und das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Die rechtlichen Grenzen sind eng gesteckt und richten sich maßgeblich danach, ob private Nutzung erlaubt oder verboten ist.
Kontrolle bei ausdrücklichem Verbot: Stichproben sind zulässig
Ist die private Internetnutzung laut Arbeitsvertrag oder IT-Richtlinie verboten, darf der Arbeitgeber grundsätzlich kontrollieren, ob dieses Verbot eingehalten wird. Er darf:
- Surfverhalten stichprobenartig auswerten
- Logfiles des Browsers einsehen
- auffällige Datenmengen prüfen
Aber: Auch in diesem Fall gelten Grenzen. Die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, dürfen nicht zur lückenlosen Überwachung führen und müssen die Intimsphäre des Arbeitnehmers wahren.
Erlaubte Nutzung: Eingeschränkte Kontrollrechte
Wenn der Arbeitgeber die private Internet- oder E-Mail-Nutzung ausdrücklich erlaubt oder über längere Zeit duldet, sind Kontrollmaßnahmen nur eingeschränkt zulässig. Das gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber in Fällen der erlaubten oder geduldeten privaten Internetnutzung als Diensteanbieter im Sinne des früheren § 88 TKG bzw. heutigen § 3 TDDDG angesehen werden. Diese Einstufung ist juristisch unklar. Aber auch ohne diese Einstufung unterliegt die Zulässigkeit von Überwachungsmaßnahmen Grenzen, vor allem denen des allgemeinen Datenschutzrechts, insbesondere der DSGVO und § 26 BDSG.
Das bedeutet konkret:
- Inhalte von E-Mails oder Browserverläufen dürfen nicht ohne konkrete Rechtsgrundlage oder Einwilligung überwacht werden.
- Die Kontrolle muss verhältnismäßig und transparent sein.
- Eine vollständige oder heimliche Überwachung ist in der Regel unzulässig.
Technische Überwachung: Was ist erlaubt?
Viele Arbeitgeber setzen technische Tools ein, um die Nutzung betrieblicher IT zu überwachen. Dazu gehören:
- Logfile-Auswertungen: Server oder Router protokollieren automatisch Verbindungsdaten wie IP-Adressen, Zugriffszeiten oder Datenvolumen. Diese Daten können ohne konkreten Anlass analysiert werden, sofern sie anonymisiert oder pseudonymisiert sind.
- Monitoring-Software: Spezialisierte Programme erfassen Systemaktivitäten auf Arbeitsplatzrechnern – z. B. welche Programme genutzt oder welche Webseiten aufgerufen wurden. Hier ist besondere Vorsicht geboten: Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt den strengen Anforderungen der DSGVO.
- Keylogger oder Screenshots: Solche Maßnahmen greifen tief in Persönlichkeitsrechte ein und sind nur bei konkretem Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten erlaubt (§ 26 Abs. 1 BDSG).
Informationspflicht und Transparenz
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, über jede Form der Überwachung vorab zu informieren. Die Informationspflicht ergibt sich aus Art. 13 DSGVO. Üblich sind:
- Hinweise in IT-Richtlinien
- Schulungen oder Mitarbeitervereinbarungen
- Aushänge oder interne E-Mails
Eine heimliche Überwachung ist grundsätzlich unzulässig – außer in seltenen Ausnahmen, z. B. bei konkretem Verdacht auf Straftaten. Auch hier gilt: Die Maßnahme muss verhältnismäßig sein und darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden.
6. Homeoffice & mobile Arbeit – was gilt außerhalb des Büros?
Das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs gehört in vielen Berufen längst zum Alltag. Doch auch wenn du im Homeoffice sitzt oder mobil arbeitest, gelten die gleichen arbeitsrechtlichen Pflichten wie im Büro – einschließlich der Regeln zur privaten Internetnutzung. Viele Beschäftigte glauben, außerhalb des Firmengebäudes sei mehr erlaubt – ein Trugschluss, der schnell Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Arbeitszeit bleibt Arbeitszeit
Auch im Homeoffice gilt: Während der vereinbarten Arbeitszeit schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die volle Arbeitsleistung (§ 611a BGB). Wer während dieser Zeit private Dinge erledigt – etwa am eigenen Blog schreibt, Texte für den Onlineshop überarbeitet oder technische CMS-Einstellungen vornimmt – riskiert eine Pflichtverletzung.
Hinzu kommt: Arbeitgeber können auch im Homeoffice überprüfen, ob die Arbeitszeit tatsächlich zur Vertragserfüllung genutzt wird. Die technischen Möglichkeiten sind je nach Ausstattung durchaus vorhanden – etwa durch VPN-Protokolle, Zeiterfassung oder Monitoring-Software.
Dienstgeräte und private Projekte: ein riskanter Mix
Besonders heikel wird es, wenn dienstliche Geräte für private Webprojekte genutzt werden. Selbst wenn du die Tools beruflich kennst – Canva, WordPress, Google Analytics & Co. – ist deren Einsatz für eigene Zwecke am Dienstgerät grundsätzlich untersagt, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis vorliegt.
Ein typisches Risiko: Du arbeitest mit WordPress an deiner privaten Seite und installierst ein Plugin aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle. Dieses enthält Schadcode, der über das Firmennetzwerk weiterverbreitet wird. Der Schaden kann erheblich sein – und zur Haftung führen.
BYOD (Bring Your Own Device): auch nicht risikofrei
Viele Arbeitnehmer nutzen im Homeoffice ihre eigenen Geräte – etwa den privaten Laptop oder das eigene Smartphone. Das kann praktisch sein, birgt aber Risiken:
- Vermischung von beruflichen und privaten Daten
- Sicherheitslücken durch fehlende Firmenrichtlinien
- Kontrollverlust für den Arbeitgeber
- potenzielle Datenschutzverstöße (z. B. durch private Cloud-Dienste)
Auch in diesem Fall gelten klare Regeln: Wer private Geräte für dienstliche Zwecke nutzt, sollte dies mit dem Arbeitgeber abstimmen und IT-Sicherheitsvorgaben einhalten.
Klare Trennung schafft Sicherheit
Wer Homeoffice und private Projekte sauber trennt, senkt das rechtliche Risiko erheblich. Empfehlenswert ist:
- die Nutzung getrennter Geräte
- eine klare zeitliche Trennung (z. B. keine privaten Tätigkeiten in Kernarbeitszeiten)
- die Nutzung eigener Datenverbindungen (z. B. Hotspot statt Firmennetz)
- das regelmäßige Prüfen von IT- und Datenschutzvorgaben
Nur so lässt sich vermeiden, dass gut gemeinte Eigeninitiative zum arbeitsrechtlichen Stolperstein wird.
7. Rechtsprechung & Praxisfälle – was sagen die Gerichte?
Die Frage, ob private Internetnutzung am Arbeitsplatz zulässig ist und welche Konsequenzen drohen, beschäftigt seit Jahren die deutschen Arbeitsgerichte. Die Entscheidungen zeigen: Es kommt auf den Einzelfall an – insbesondere auf das Ausmaß, den Zeitpunkt und die technischen Mittel der Nutzung. Drei Urteile zeigen beispielhaft, was erlaubt ist – und was nicht.
LAG Rheinland-Pfalz: Kündigung ohne vorherige Abmahnung unwirksam
Im Fall des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz (Urteil vom 26.02.2010 –6 Sa 682/09) hatte ein Mitarbeiter gegen seine ordentliche Kündigung geklagt, weil er während der Arbeitszeit private Internetseiten besucht hatte – unter anderem zur Abfrage seines Kontostands. Zwar war die private Nutzung im Unternehmen verboten, dennoch sah das Gericht in dem Verhalten keine so schwerwiegende Pflichtverletzung, dass eine sofortige Kündigung ohne vorherige Abmahnung gerechtfertigt gewesen wäre.
Das Gericht betonte, dass der Arbeitgeber nicht ausreichend dargelegt habe, wie lange der Kläger sich tatsächlich im Internet aufgehalten hatte oder ob eine spürbare Beeinträchtigung der Arbeitsleistung vorlag. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Zugriffe während der Pause oder im dienstlichen Zusammenhang erfolgt waren. Unter diesen Umständen sei der Kündigung eine Abmahnung zwingend vorzuschalten gewesen.
Fazit: Auch bei Verstoß gegen ein klares Nutzungsverbot ist eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung nicht immer zulässig – vor allem, wenn die Nutzung geringfügig bleibt und die Arbeit nicht nachweislich leidet.
LAG Köln: Fristlose Kündigung bei exzessiver privater Internetnutzung wirksam
Im Fall des Landesarbeitsgerichts Köln (Urteil vom 07.02.2020 – 4 Sa 329/19) hatte ein IT-Dienstleister seinem einzigen Mitarbeiter fristlos gekündigt, weil dieser über Monate hinweg regelmäßig und an mehreren Tagen während der Arbeitszeit das Internet und den dienstlichen E-Mail-Account privat genutzt hatte – trotz eines klaren vertraglichen Verbots. Die Auswertung von Browserverlauf und E-Mails ergab, dass zwischen den privaten Aktivitäten jeweils nur kurze Pausen lagen, sodass kaum Arbeitsleistung erbracht werden konnte.
Das Gericht sah darin eine schwerwiegende Pflichtverletzung und bestätigte die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung – eine Abmahnung sei bei diesem Umfang und der Intensität der privaten Nutzung entbehrlich. Die Interessenabwägung fiel zugunsten des Arbeitgebers aus, zumal der Arbeitnehmer das Verbot kannte und dennoch massiv dagegen verstieß.
Fazit: Bei exzessiver privater Internetnutzung während der Arbeitszeit trotz ausdrücklichen Verbots kann eine fristlose Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung wirksam sein.
LAG Rheinland-Pfalz: Fristlose Kündigung wegen privater E-Mails und Nebentätigkeit
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied am 24. Oktober 2019 (Az. 5 Sa 66/19), dass einem Arbeitnehmer fristlos gekündigt werden durfte, weil er während der Arbeitszeit über das Firmennetzwerk regelmäßig private E-Mails versendete und an Projekten seiner Nebentätigkeit arbeitete. Der Betroffene betrieb nebenbei eine Werbeagentur und hatte dabei dienstliche Ressourcen wie Laptop, Strom, Internetverbindung sowie sein Büro für private Zwecke genutzt. Selbst Visitenkarten seiner Nebentätigkeit hatte er am Arbeitsplatz aufbewahrt. Der Arbeitgeber hatte ihn zuvor bereits ausdrücklich auf das Verbot hingewiesen. Das Gericht sah in dem Verhalten eine erhebliche Pflichtverletzung, die eine sofortige Kündigung rechtfertigte – auch ohne vorherige Abmahnung.
Fazit: Wer trotz Warnung regelmäßig während der Arbeitszeit privat arbeitet und betriebliche Ressourcen nutzt, riskiert die fristlose Kündigung.
Was lernen wir daraus?
Diese Entscheidungen machen deutlich: Auch vermeintlich harmlose Handlungen wie das Versenden privater E-Mails oder gelegentliches Surfen im Internet können arbeitsrechtlich relevant werden – vor allem dann, wenn betriebliche Ressourcen systematisch für private Zwecke genutzt oder Verbote missachtet werden. Wer sich an seinem Arbeitsplatz wiederholt privaten Aufgaben widmet, ohne dass dies ausdrücklich erlaubt ist, riskiert ernste Konsequenzen – bis hin zur fristlosen Kündigung.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte:
- die eigene Nutzung kritisch hinterfragen
- sich bei Unklarheiten rechtzeitig absichern
- die betriebliche IT-Infrastruktur nicht für private Zwecke verwenden
8. Handlungsempfehlungen für Websitebetreiber
Eigene Websites, Blogs oder Online-Shops betreiben – das ist für viele nicht nur Hobby, sondern auch eine Einnahmequelle oder langfristige Selbstständigkeitsperspektive. Gerade im digitalen Bereich liegt es nahe, am Arbeitsplatz gelegentlich private Projekte zu pflegen. Doch aus arbeitsrechtlicher Sicht ist Vorsicht geboten. Wer dienstliche Ressourcen nutzt oder während der Arbeitszeit an privaten Webseiten arbeitet, bewegt sich schnell auf unsicherem Terrain.
Was macht Webseitenbetreiber besonders anfällig?
Im Unterschied zu rein konsumierender Internetnutzung (z. B. Social Media oder YouTube) ist die Bearbeitung einer Website oft mit technischen Eingriffen, längeren Zeitaufwänden und externen Zugriffen verbunden. Typische Risiken:
- Verletzung der Arbeitspflicht durch längeres Arbeiten an privaten Inhalten
- Sicherheitsrisiken durch fremde Plugins oder Scripte
- Verstoß gegen Nebentätigkeitsklauseln, wenn das Projekt kommerziell ist
- Verletzung betrieblicher IT-Richtlinien, etwa bei Nutzung von CMS, Tools oder Cloud-Diensten
Selbst scheinbar „kurze Eingriffe“ wie das Aktualisieren eines Impressums oder das Freischalten eines Kommentars können problematisch sein – wenn sie während der Arbeitszeit erfolgen oder dienstliche Infrastruktur betreffen.
Checkliste: So schützt du dich
Die folgende Checkliste hilft dir, rechtliche Risiken zu minimieren:
- Arbeitsvertrag prüfen: Gibt es Klauseln zur Nebentätigkeit? Wie ist private Nutzung geregelt?
- IT-Richtlinien beachten: Sind bestimmte Tools, Websites oder Cloud-Dienste untersagt?
- Eigene Geräte verwenden: Vermeide private Aktivitäten am Dienstrechner.
- Eigene Datenverbindung nutzen: Nutze Hotspot oder mobile Daten statt Firmennetz.
- Zeitlich trennen: Arbeite an deiner Website nur in Pausen oder außerhalb der Arbeitszeit.
- Projekt anmelden: Kläre mit deinem Arbeitgeber, ob du deine Website als Nebentätigkeit anmelden musst.
- Regelmäßige Updates: Halte dich über aktuelle rechtliche Entwicklungen und Sicherheitsanforderungen auf dem Laufenden.
Konkrete Tipps für typische Webprojekte
| Webprojekt | Besonderheit | Empfehlung |
| Blog oder Ratgeberseite | u. U. kommerziell (Werbung) | Nebentätigkeit prüfen und Arbeitszeit beachten |
| Online-Shop | meist kommerziell, erhöhte Datenverarbeitung | nur über eigene Geräte und nach Feierabend betreiben |
| Portfolio-/Referenzseite | kann berufsnah sein | auf Interessenskonflikte mit Arbeitgeber achten |
| Affiliate-Projekt | monetarisiert, oft CMS-basiert | kein Zugriff über Firmennetz |
| Forum oder Community-Seite | ggf. zeitintensiv (Moderation etc.) | nur außerhalb der Arbeitszeit administrieren |
Fragen und Antworten
Ja, grundsätzlich schon – vor allem, wenn du dein eigenes Gerät und deine eigene Datenverbindung nutzt. Die Pause gehört dir, und dein Arbeitgeber darf dir in dieser Zeit nicht vorschreiben, wie du sie verbringst. Einschränkungen gelten nur, wenn du dabei betriebliche Ressourcen nutzt, z. B. den Dienstrechner oder das Firmennetzwerk. Das ist nur erlaubt, wenn es vom Arbeitgeber ausdrücklich gestattet oder über längere Zeit hinweg geduldet wurde.
Nur, wenn dein Arbeitgeber das erlaubt oder duldet. Ohne entsprechende Regelung ist jede private Nutzung – auch für wenige Minuten – ein Verstoß gegen deine Arbeitspflicht. Besonders heikel wird es, wenn du dabei regelmäßig Zeit verlierst oder betriebliche Geräte nutzt.
Auch kurze Eingriffe – z. B. ein Plugin-Update oder das Freischalten eines Kommentars – sind heikel, wenn sie während der Arbeitszeit oder über den Dienstrechner erfolgen. Selbst wenn es nur wenige Minuten sind, kann dies als Pflichtverletzung gewertet werden, insbesondere wenn private Nutzung untersagt ist.
Der Arbeitgeber darf kontrollieren, ob die Internetnutzung betrieblichen Vorgaben entspricht – aber nicht unbegrenzt. Bei verbotenem Surfen sind stichprobenartige Kontrollen zulässig. Inhalte (z. B. E-Mails oder Browserverläufe) dürfen nur bei konkretem Verdacht und unter strengen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen ausgewertet werden. Heimliche Überwachung ist in der Regel verboten.
Das hängt vom Einzelfall ab. Möglich sind Ermahnung, Abmahnung oder sogar Kündigung – im Extremfall auch fristlos, etwa bei systematischer, zeitintensiver oder sicherheitsrelevanter Nutzung. Wenn durch deine Aktivität ein Schaden entsteht (z. B. durch Schadsoftware), kann sogar eine Schadensersatzpflicht drohen.
Sobald du mit deiner Website Einnahmen erzielst – z. B. durch Werbung, Affiliate-Programme oder Produktverkäufe – gilt sie in vielen Arbeitsverhältnissen als genehmigungspflichtige Nebentätigkeit. Auch ohne Einnahmen kann eine Anmeldung erforderlich sein, wenn das Projekt zeitlich anspruchsvoll ist oder im Wettbewerb zum Arbeitgeber steht.
Weitere Beiträge zum Thema Website-Recht
- Impressum-Generator (2026): Website-Impressum kostenlos erstellen Artikel lesen
- Impressum für Blogs: Anleitung, Muster & Tipps (2026) Artikel lesen
- Impressum für private Homepage: Anleitung, Muster & Tipps (2026) Artikel lesen
- Impressum für Rechtsanwälte: Anleitung, Muster & Tipps (2026) Artikel lesen
- Impressum für Vereine: Anleitung, Muster & Tipps (2026) Artikel lesen
- Impressumspflicht bei Apps: Hintergrund und Umsetzung Artikel lesen
- Impressumspflicht bei Facebook: das musst du wissen! Artikel lesen
- Impressumspflicht: Haftung und Sanktionen (2026) Artikel lesen
- Google Bewertungen löschen: So gelingt es! Artikel lesen
- Abmahnung mit Unterlassungserklärung: so verhältst du dich richtig Artikel lesen
- Pflichtangaben im Impressum (2026): so machst du es rechtlich sauber Artikel lesen
- Website-Disclaimer: welche Vorlagen und Muster sind rechtswirksam? Artikel lesen
- Abmahnung wegen fehlerhaftem Impressum: So schützt du dich! Artikel lesen
- Private Internetnutzung am Arbeitsplatz Artikel lesen
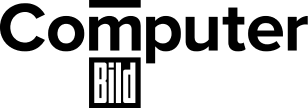
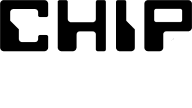
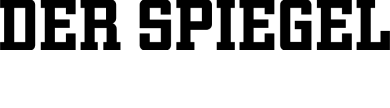



Kommentare und Bewertungen
Hat dir der Beitrag weitergeholfen?
Artikel bewerten
Artikel teilen